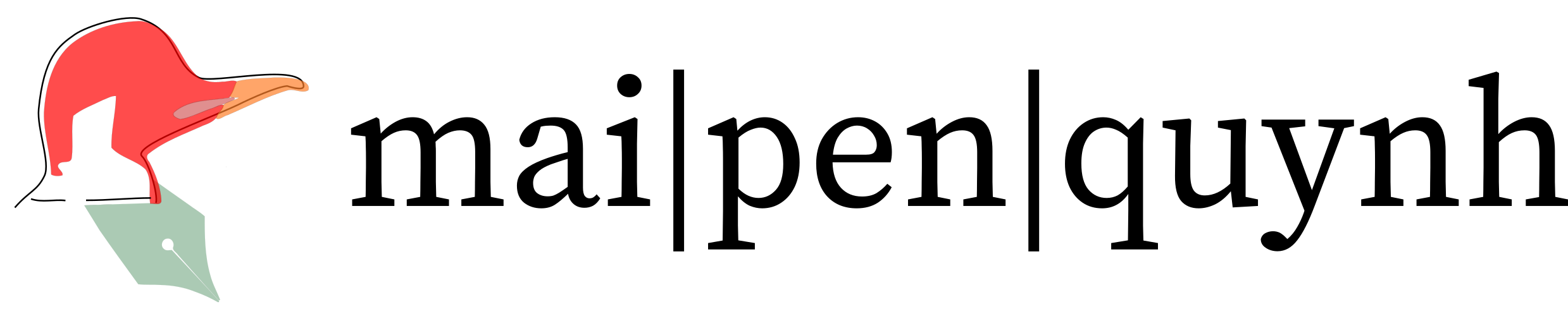Hier setze ich mit Teil 2 die kleine „Chronik“ fort, in der ich erzähle wie ich zur Fotografie kam. Zu Teil 1.

3 – Filme selbst entwickeln und Schwarzweißfotografie
Am Anfang habe ich eigentlich nur Farbfilme benutzt. Ich habe vorrangig auch die günstigen aus der Drogerie benutzt ^^“. Schwarzweißfilme waren zu teuer für mich und ich hatte noch nicht so sehr den Hang zu Schwarzweißfotos gehabt. Es galt: Hauptsache Fotos vom Film.
In der Schule bin ich im Keller auf einen Raum gestoßen, der mit „Fotolabor“ beschriftet war. Der war aber abgeschlossen und wurde nicht benutzt. Für eine Schularbeit habe ich mich dann bisschen mehr mit der Entwicklung vom Film beschäftigt und hatte dadurch Zugang zum Fotolabor bekommen. Tatsächlich habe ich keinen Film entwickelt und auch keine Fotoabzüge gemacht. Aber es dürfte mit ein Auslöser gewesen sein, dass ich seitdem lernen will, Filme selbst zu entwickeln und Abzüge zu machen.
Mir wurde vermittelt, dass das Entwickeln von Schwarzweißfilmen einfacher war als von Farbfilmen. Das könnte ein Grund sein, warum ich mehr Interesse an der Schwarzweißfotografie entwickelt habe. Darüber hinaus habe ich auch tatsächlich mehr Faszination an Schwarzweißfotos gefunden. Diese Reduktion auf ein Spektrum zwischen schwarz und weiß und vielen Grautönen, ganz ohne Farbe.
4 – Kaum Fortschritte in mehr als 10 Jahren
Jetzt kommen wir zu dem etwas traurigen Teil, wie ich finde.
Meine erste SLR (= single lense reflex, dt. Spiegelreflex(kamera)) habe ich so um 2009 gekauft. Das bedeutet, seither sind mehr als 10 Jahre vergangen und in diesen kann viel gelernt werden.
Und obwohl die Fotografie immer einen Platz bei mir hatte, war mein Interesse nie groß genug, dass ich mich wirklich dahinter geklemmt habe. Ich habe meine Kamera(s) immer wieder benutzt, aber mich nicht mehr damit auseinandergesetzt. Ich hatte nie den langfristigen Impuls, mich in dieses Fachgebiet hineinzuarbeiten und so dümpelte die Fotografie vor sich hin (#scannerdasein ?).
Dadurch habe ich in all diesen Jahren eigentlich kaum Fortschritte gemacht. Immer wieder habe ich mir mal Literatur geholt und bisschen gelesen, aber nie den Schritt gewagt, praktisch zu lernen. Und das ist für die Fotografie als Handwerk natürlich unpraktisch.
Aber die Faszination für und mein Interesse an Fotografie bleibt. Und alles was ich brauche, habe ich zuhause: Sowohl Kamera als auch Filmrollen.
5 – Impulse, um besser zu werden: Instagram, Gedanken, der Blog
… Und so bleibt mir fast nichts anderes als diese Filme zu verschießen!
Naja, nicht ganz. Es gibt noch weitere Impulse als nur das bestehende Equipment, die mich dazu brachten, dass ich Fotografie nun auf meine Freizeitagenda werfe – for real.
Instagram. Gut geschossene Fotos kommen oft im Feed vorbei und das löst in mir schon Neidgefühl aus. Ich sehe, was möglich ist und denke mir, dass ich das auch gern können will. Es ist kein gesunder Impuls, weil destruktiver Vergleich im Mittelpunkt steht. Aber es bleibt dennoch ein Impuls, meine fotografischen Skills verbessern zu wollen.
Gleichzeitig frage ich mich oft: Wie viel ist ein Foto (noch) wert? Was bedeutet ein Foto der Person, die es schießt und es auf Instagram postet? Allen voran merke ich das natürlich an mir: Für wen fotografiere ich gerade? Denn: Ich will eigentlich mehr als „bloß“ ein instagrammable photo schießen und posten, um Likes zu kassieren und dadurch mein Selbstwertgefühl zu pushen.
Mein letzter Impuls: Dieser Blog. Fotos und Blogs hängen seit jeher für mich eng zusammen. In der Hochphase der Blogs erschien es mir, dass Blogger:innen auch immer irgendwie Fotograf:innen waren. Auch wenn das nur eine Nische an Blogs ist und Blogs ohne Fotos ebenso interessant und gut sind. Der Blog ist einfach ein schönes Medium, um diese beiden Interessen zu verbinden: Schreiben und fotografieren – daher kommt diese Kombination häufig vor. Ich versuche bisher immer ein Bild einzubinden, aber es sind bisher ziemlich häufig Stockphotos 😀 Wahrscheinlich werde ich auch weiterhin nicht viele eigene Fotos für meine Posts schießen, da ich bisher immer noch mit wenig Konzept pro Blogpost arbeite.
Dennoch sehe auch ich den Blog als passendes Medium, um mein fotografisches Interesse auszuleben und zu präsentieren. Schön wäre es auf jeden Fall, Fotos mit Konzept für einen Blogpost zu erstellen. Aber ich bin auch schon zufrieden, wenn ich Fragen erörtere wie: Wie lerne ich, wie übe ich, wie scheitere ich? Was bedeutet mir Fotografie und wie weit bin ich bereit zu gehen und zu investieren?
Schlusswort
Auch wenn ich einen fachlichen Fokus habe, so werde ich auf dem Weg dorthin vieles lernen, was nicht nur für diese, sondern für jede Art der Fotografie relevant ist. Wer weiß, ob ich bei der analogen Schwarzweißfotografie bleibe oder nicht doch woanders meine Leidenschaft finde. Wie immer, wenn es ums Lernen und Ausprobieren von Dingen geht: Ich bin gespannt, was wird!